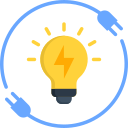This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Die Rolle von Elektrofahrzeugen bei der Reduzierung von CO₂-Emissionen
Elektrofahrzeuge (EVs) spielen eine immer bedeutendere Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Als Alternative zu konventionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bieten sie das Potenzial, die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor massiv zu verringern. Vor allem in Ländern wie Deutschland, in denen die Umsetzung der Klimaziele eine große Herausforderung darstellt, setzen viele Experten und Entscheidungsträger verstärkt auf die Elektrifizierung der Mobilität. Dabei umfasst die Reduzierung von CO₂-Emissionen nicht nur den Wegfall von Abgasen im Betrieb, sondern auch Veränderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Energieerzeugung bis zum Recycling der Fahrzeuge. Dieser Text beleuchtet die wichtigsten Aspekte der Rolle von Elektrofahrzeugen bei der Minderung von Kohlendioxidemissionen.

Reduzierung der Emissionen im Fahrbetrieb

Produktion und Lebenszyklusbetrachtung

Auswirkungen auf die lokale Luftqualität
Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrssystems

Förderung erneuerbarer Energien im Verkehrssektor

Integration in nachhaltige Mobilitätskonzepte